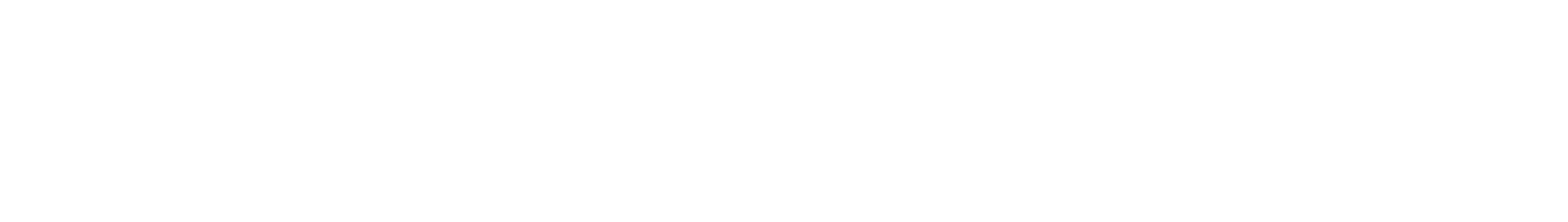
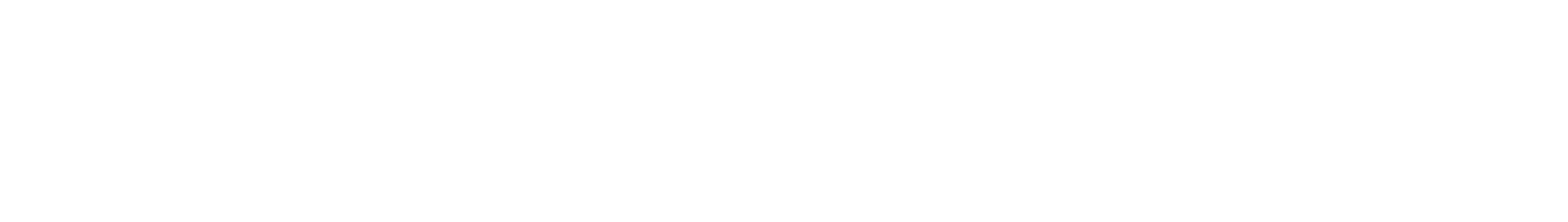
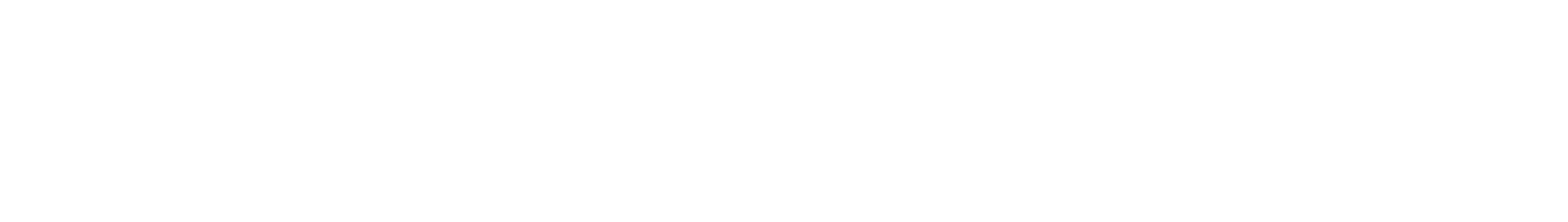
Referat von Markus Theunert am Männersymposium vom 7. September 2024 zum Thema «Männerarbeit zwischen Rückbesinnung, Privilegienkritik und Aufbruch: eine Positionierung»
Das übergeordnete Ziel unserer Bemühungen als Dachverband der progressiven Schweizer Männer- und Väterorgansationen ist Folgendes: Wir möchten, dass die Arbeit mit Buben, Männern und Vätern selbstverständlicher Teil der kantonalen Grundversorgung wird. Genauso wie heute Familienberatung, Gewaltprävention, Elternarbeit, Jugendzentren und Suchthilfe als Infrastrukturstandard gelten, müssen aus unserer Sicht Angebote der Bubenarbeit, Männerberatung und Väterbildung für alle zugänglich sein. Die Situation heute ist aus unserer Sicht unbefriedigend und unhaltbar.
Denn Angebote für Männer werden ja nur gefördert, wenn Männer Probleme machen, namentlich Angebote für gewalttätige Männer. Bei der Bearbeitung all der Probleme und Herausforderungen, die Männer haben, bleiben sie auf sich allein gestellt.
Diese Einbettung ist wichtig für die Einordnung: Es geht mir im Folgenden nicht darum, bestimmte Formen von Männerarbeit zu bewerten. Es geht um eine Begründung, was Männerarbeit leisten muss, damit wir guten Gewissens einen Nutzen für die ganze Gesellschaft – und nicht nur für den einzelnen Mann – in Anspruch nehmen können. Das wiederum ist notwendige Voraussetzung, um realistische Aussicht auf Unterstützung durch öffentliche Mittel zu haben.
Die erste Ansage: Männerarbeit ist wissenschaftlich fundiert.
Ich postuliere damit nicht, Männerarbeit müsse jeden einzelnen Interventionsschritt empirisch belegen und schon gar nicht will ich einer blinden Wissenschaftsgläubigkeit das Wort reden. Ich fordere aber sehr wohl das Bemühen um ein theoretisches Fundament, um überprüfbare Instrumente und begründete Wirkungsannahmen, eine Auseinandersetzung mit aktuellen wissenschaftlichen Debatten auch. Ein isolierter Bezug auf Intuition und Praxis reicht nicht.
Für die Männerarbeit gibt es Bezugspunkte zu verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen: zur Psychologie und Pädagogik, zur Sozialen Arbeit und Geschlechterforschung, zur Soziologie und Biologie beispielsweise. Natürlich gibt es auch zwischen diesen Disziplinen viele Diskussionen und Dispute. So nah heranzoomen müssen wir aber gar nicht. Denn in den grundlegenden Fragen existiert sehr wohl ein fächerübergreifender Konsens, auf den wir uns abstützen können. Das gilt auch für die konkrete Gretchenfrage, die für jede Männerarbeit grundlegend ist: Wie kommt das Geschlecht in den Mann?
Darüber lässt sich trefflich streiten. Auf sicherem Grund sind wir mit der Aussage: Mannsein entfaltet sich nicht entlang eines natur- oder gottgegebenen Bauplans, sondern entwickelt sich in Wechselwirkung zwischen natürlichen Anlagen und sozialen Einflüssen. Damit wir auch begrifflich kein Durcheinander machen, ist es für die Verständigung sinnvoll, ein paar Begriffe zu schärfen.
Wir müssen also stets ein Dreifaches im Auge haben: erstens den Mann, zweitens die gesellschaftlichen Männlichkeitsanforderungen und drittens die Frage, wie wir uns zu diesen Anforderungen verhalten resp. wie diese auf uns einwirken. Damit ist auch gesagt: Mannsein ist kein Zustand, sondern ein Prozess: (Sich) männlich zu erleben und zu verhalten, wird erlernt und fortlaufend reproduziert oder auch verändert. Männer können wählen, wie sie ihr männliches Selbstverhältnis gestalten. Aber sie sind gezwungen, sich in der einen oder anderen Weise zu Männlichkeitsanforderungen verhalten.
Dadurch ist schon recht gut bestimmt, was die Kernaufgabe von Männerarbeit ist: Männer dabei zu unterstützen, sich in einer Weise auf gesellschaftliche Männlichkeitsanforderungen zu beziehen, die zu ihnen passt und die ihnen und ihrem Umfeld guttut. Das können wir aber nur, wenn wir genau verstehen, wie dieser Lernprozess, dieses «doing masculinity» funktioniert. Das ist die Voraussetzung, damit wir identifizieren können, was Männer verlernen müssen, um sich emanzipieren, befreien und solidarisieren zu können. Was ist das Einengende, Ungesunde, Hinderliche männlicher Sozialisation? Schauen wir genauer hin.

Die zweite Ansage: Männerarbeit geht nicht ohne «unlearning masculinity».
Ich habe versucht, in 10 Aussagen zu bündeln, was wir über männliche Sozialisation wissen:
Ich zeichne also ein Bild männlicher Sozialisation, das stark geprägt ist von Entfremdungs- und Zurichtungsdynamiken. In einem Satz: Mann werden heisst, Gefangener und Wächter in Personalunion zu sein. Ich muss das, was meinen Rang bedroht – die Sprache sagt’s ja ganz direkt: was meine «Männlichkeit» bedroht – unter Verschluss halten. Manche Männer bauen einen Zaun. Die meisten aber errichten Mauern – und nicht wenige einen schalldichten Bunker.
In dieser Metapher wird die übergeordnete Aufgabe von Männerarbeit schön fassbar: Sie ist gefordert, den Mann in Kontakt und Verbindung zu bringen mit seinen gefangenen, weggesperrten, unterdrückten Gefühlen, Bedürfnissen und Sehnsüchten. Darin ist auch eine Zielrichtung enthalten:
Männer sollen freier und selbstbestimmter entscheiden können, wie sie Mann und Mensch sein wollen.
Die dritte Ansage: Männerarbeit macht Männer freier und selbstbestimmter.
Aus unserer Sicht ist es eben gerade nicht Aufgabe von Männerarbeit, inhaltlich zu bestimmen, wohin die Reise gehen soll. Denn sonst würden wir bloss die alte Norm des leistungsstarken Alphamanns durch eine neue Norm ersetzen. Wie lebenswert auch immer die wäre: Sie würde nicht die Freiheit vermehren, sondern neue Zwänge setzen. Genau das ist das Kriterium, anhand dessen ihr erkennen könnt, ob Angebote der Männerarbeit wirklich eure Emanzipation fördern, euch freier machen, euren Weg heim zu euch selbst bahnen. Das Kriterium heisst: Schafft sie es, auf neue Zwänge und Korsette zu verzichten?
Wenn ich mir anschaue, was für Männerangebote es mir in meine Social Media-Kanäle spült, dann erfasst mich zuweilen das kalte Grauen. Da werden Gebrauchsanweisungen und Checklisten verkauft, die Männern Erfolg im Job oder im Bett versprechen. Da werden Gruppenerlebnisse beworben, die bedingungslose Unterordnung verlangen statt dass sie die Kompetenz stärken, zu sich selbst zu stehen. Da werden Annahmen getroffen, die einer seriösen fachlichen Überprüfung einfach nicht standhalten.
Ich muss es mit aller Deutlichkeit sagen: Es gibt keine Essenz des Männlichen, die über alle Epochen und Kulturen hinweg gilt und an der wir uns festhalten könnten. Die Natur ist zu bunt, die Menschheit zu erfindungsreich, die Entwicklung zu rasant. Es gibt auch keine Wesensmerkmale, die alle Penisträger vereint. Es gibt keine Kompetenzen, die nur Männer erwerben können. Es gibt keine Persönlichkeitseigenschaften, die nur Männer haben. Es gibt schon gar keine Gefühle, die nur Männer fühlen. Ich will damit nicht sagen, dass es keine biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Ich möchte uns aber sensibilisieren für den Umstand, dass wir mit der «biologischen Brille» ständig Gefahr laufen, auch zufällige oder kulturell vermittelte Differenzen in den Rang einer «natürlichen Ungleichheit» zu erheben – und damit für alle Ewigkeit festzuschreiben.
Bei männer.ch sagen wir: Letztlich ist die Frage erkenntnistheoretisch nicht lösbar, wieviel am geschlechtlichen Ausdruck durch die Natur unveränderbar angelegt ist. Deshalb starten wir doch mit der Annahme, Veränderungen seien möglich. Wenn wir sehen, dass es keine Veränderung gibt, führt dann immer noch ein Weg zurück. Das funktioniert umgekehrt aber nicht. Wenn wir bereits mit der Annahme starten, dass die Natur gar keinen Spielraum lasse, werden wir gar nie herausfinden, was alles möglich gewesen wäre…!
Wenn wir männliche Sozialisation verlernen wollen, werden wir um die Verunsicherung nicht herumkommen. Es geht nicht drum, dass sich Männerarbeit immer «gut» anfühlen muss. Sie darf sich aber nie manipulativ anfühlen, zwanghaft, beengend. Als Faustregel möchte ich euch mit auf den Weg geben: Wann immer euch das vermeintlich Neue vertraut vorkommt, ist Vorsicht geboten…
Meine klare Empfehlung und Ermunterung: Lasst uns vorwärts gehen! Wir haben die historische Chance, uns als Männer jenseits des unsichtbaren Zwangs zur Männlichkeit neu zu erfinden. Lasst uns das als Geschenk annehmen und feiern!
Die vierte Ansage: Männerarbeit ist politisch.
Es ist offensichtlich, dass die Gesellschaft nicht bereit ist, das historisch privilegierte Geschlecht des Verlusts seiner Privilegien willen zu bedauern. Das ist anzuerkennen. Aber davon müssen wir uns nicht lähmen lassen. Wir können aktiv werden. Wir müssen uns nicht schämen oder schuldig fühlen, für das, was der patriarchale Spätkapitalismus uns, unseren Lieben und unserem Planeten antut. Damit wir aber auf eine gute, würdige, respektable Art Mann sein können, braucht es eine klare innere Haltung und eine klare Abgrenzung: Ja zum Mann. Nein zur Männlichkeit als Herrschaftsprinzip. Nein zu Männlichkeitsimperativen, die krank, eng und ängstlich machen.
Solch ein Bekenntnis hat Folgen: Wenn Männerarbeit Freiheit und Selbstbestimmung fördern will, kann sie gar nicht anders als privilegien- und machtkritisch zu sein. Die Unterscheidung zwischen Männlichkeit als Disziplinierungsprinzip und Männern als menschlichen Subjekten ist ja ihre Grundlage. Die damit verbundenen Konflikte muss Männerarbeit aushalten.
Wir sollten uns trauen, den faulen Deal zu sehen, den uns das Patriarchat vorschlägt. Wir sollten uns trauen, das Angebot laut und deutlich abzulehnen: Klar, alle sollen machen, was sie wollen. Aber Nein: Wir wollen keine Gesellschaft, die es «männlich» und normal findet, wenn Männer rasen, prügeln, saufen und Sex kaufen. Wir wollen keine Gesellschaft, die es normal findet, dass Männer alle Statistiken anführen, in denen es darum geht, sich sinnlos ums Leben zu bringen. Wir wollen keinen Leistungsimperativen hinterherhecheln, die unser Konto bereichern, aber unsere Seelen verarmen lassen.
Als ich geboren wurde, hätte meine Mutter ohne Zustimmung meines Vaters keinen Beruf ausüben und kein Konto eröffnen können. Als ich geboren wurde, hätte mein Vater meine Mutter noch ganz legal vergewaltigen dürfen. Was ist das für ein System, das glaubt, es steigere unseren Selbstwert als Mann, wenn es uns nahelegt, unsere Liebsten zu unterdrücken, zu schlagen, auszubeuten? Was ist das für ein Männerbild, das davon ausgeht, es bereite Männern Spass, wenn sie andere leiden sehen?
Es gibt keine männliche Erbschuld. Wir können nicht für das verantwortlich gemacht werden, was unsere Väter und Vorväter verbockt oder versäumt haben. Aber als historisch privilegiertes Geschlecht haben wir eine Verantwortung: Dass wir unsere Ressourcen nutzen, um ein besseres Leben für alle zu ermöglichen.
Lassen wir uns dabei keinen Sand in die Augen streuen: Das Patriarchat ist nicht überwunden, nur weil es sich ein bisschen lockerer gemacht hat und nun auch jenen Frauen Zutritt in die Sphären der Macht gewährt, die seine Spielregeln übernehmen. Das Patriarchat sitzt fest im Sattel und die meisten Männer spielen als Komplizen munter mit. Wir dürfen uns mit ihnen nicht aus einer falsch verstandenen Brüderlichkeit heraus verbünden. Wir brauchen eine mitmännliche Solidarität, um zusammen mit allen gesellschaftlichen Kräften eine lebenswerte Zukunft zu gestalten, die ihr Handeln an Werten wie Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Respekt ausrichten.
Männerarbeit ist in dieser Situation immer auch politisch. Männerarbeit, welche die Arbeit am Persönlichen selbst löst von den Verhältnissen, in denen sie stattfindet, zementiert diese Verhältnisse. Lasst uns keinem kollektiven Egoismus frönen, der uns das Leben leichter macht, während uns die Welt da draussen nicht mehr schert.
Das wohl niederträchtigste Vermächtnis des Patriarchats ist die Angst, die uns Männern eingepflanzt wird, in unserem Innersten lauere das Böse, das Gewalttätige, das Dunkle. Das ist eine Lüge. Wir können uns vertrauensvoll unserem Inneren zuwenden. Wir dürfen uns um uns kümmern. Wir dürfen uns selbst lieben. Wir dürfen zu uns und unseren Mitmännern Sorge tragen. Weil auch Männer Menschen sind, kann aus dieser Verbundenheit nur eines wachsen: die Liebe zum Leben und der Wunsch nach einer Welt, in der alle Menschen frei und sicher wachsen können.
